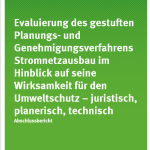Keine Entschädigung für Ausgleichsenergie nach der Härtefallklausel

In einer aktuellen Entscheidung des OLG Bamberg vom 08.02.2024 (8 U 141/22) findet eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten, in denen von einer Abregelung einer EEG-Anlage Betroffene Mehrkosten für bezogene Ausgleichsenergie nach der Härtefallklausel des § 15 EEG a.F. geltend gemacht haben, mutmaßlich seinen Schlusspunkt.
Inzwischen haben mehrere Oberlandesgerichte entschieden, dass dem bilanzkreisverantwortlichen Direktvermarkter kein Anspruch auf Ersatz für abregelungsbedingte höhere Ausgleichsenergiekosten gegen den abregelnden Netzbetreiber zusteht. Dabei wurde über vielfältige Sachverhaltskonstellationen und unterschiedliche rechtliche Argumentationsversuche entschieden. Allen gemeinsam war jeweils, dass dem in § 15 Abs. 1 EEG a.F. (und Vorgängernormen) nicht adressierten Direktvermarkter ein Anspruch auf Ersatz dieser Mehrkosten als „zusätzliche Aufwendungen“ beschert werden sollte. Sämtliche Verfahren verliefen für die Direktvermarkter erfolglos. Etwaige Nichtzulassungsbeschwerden wurden vom BGH zurückgewiesen.
Das Novum in dem durch das OLG Bamberg zu entscheidenden Sachverhalt lag allerdings darin, dass anstelle des Direktvermarkters der Anlagenbetreiber selbst, nachdem er die höheren Ausgleichsenergiekosten an den Direktvermarkter erstattet hatte, als finanziell belasteter Kläger auftrat. Gleichwohl hat das OLG Bamberg unter Verweis auf die anderen obergerichtlichen Urteile entschieden, dass die freiwillige Erstattung durch den Anlagenbetreiber aus den Ausgleichsenergiekosten des Direktvermarkters keineswegs erforderliche und notwendige Aufwendungen des Anlagenbetreibers im Sinne der Härtefallklausel mache.
Dazu fehle es insbesondere an der erforderlichen Unmittelbarkeit zwischen Einspeisemanagementmaßnahme und Aufwendung, die zudem im eigenen Interesse des Anlagenbetreibers erfolgen müsse. Denn die Kosten für die Ausgleichsenergie fielen (unmittelbar) beim Direktvermarkter als Bilanzkreisverantwortlichem und nicht beim Anlagenbetreiber an. Die Belastung des Anlagenbetreibers trete erst durch dessen Vereinbarung mit dem Direktvermarkter ein. Ungeachtet dieses Zwischenschritts, der die Unmittelbarkeit entfallen ließe, werde die Vereinbarung zudem allein zu Gunsten des Direktvermarkters und gleichzeitig zu Lasten des Netzbetreibers geschlossen. Ein eigenes Interesse des Anlagenbetreibers an der Vereinbarung, mit der lediglich die Weiterbelastung begründet werde, existiere nicht. Darüber hinaus verstieße die Vereinbarung des Direktvermarkters mit dem Anlagenbetreiber auch gegen dessen Schadensminderungspflicht, so dass die Aufwendungen des Anlagenbetreibers nicht erforderlich und daher ohnehin nicht ersatzfähig seien.
Für die Zulassung der Revision sah das OLG Bamberg keinen Anlass, da es von den Entscheidungen anderer Oberlandesgerichte nicht abgewichen sei.
Für nähere Informationen zu diesem und anderen vorangegangen Verfahren, die durch uns betreut wurden, wenden Sie sich gerne an uns.

 Für EltVU und Eigenversorger besteht nunmehr die harte Gewissheit, dass sie mit Blick auf die EEG-Meldepflichten gleichsam einer Garantiehaftung unterliegen: Bleibt rein objektiv am Ende eines Kalenderjahres die gemeldete hinter der tatsächlich angefallenen Strommenge zurück, löst dies ohne weiteres Zinsansprüche des ÜNB für die auf die Differenzmenge entfallende EEG-Umlage aus – und zwar in empfindlicher Höhe von 5% p. a.
Für EltVU und Eigenversorger besteht nunmehr die harte Gewissheit, dass sie mit Blick auf die EEG-Meldepflichten gleichsam einer Garantiehaftung unterliegen: Bleibt rein objektiv am Ende eines Kalenderjahres die gemeldete hinter der tatsächlich angefallenen Strommenge zurück, löst dies ohne weiteres Zinsansprüche des ÜNB für die auf die Differenzmenge entfallende EEG-Umlage aus – und zwar in empfindlicher Höhe von 5% p. a.