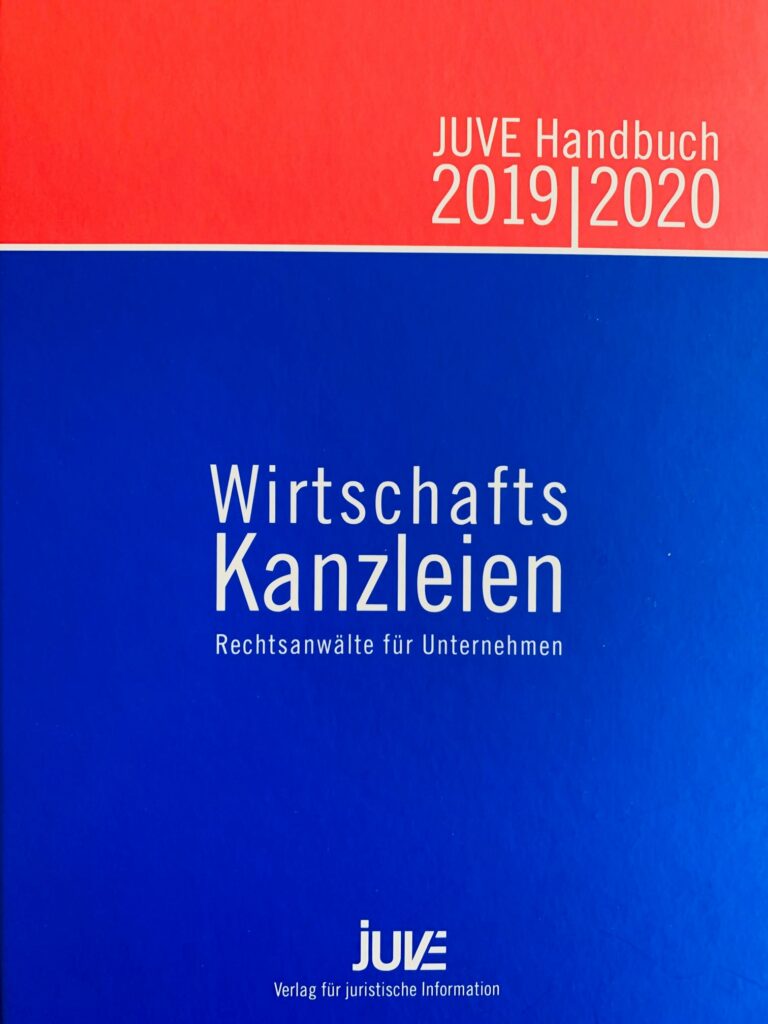Stromsteuerlicher Handlungsbedarf zum 31.12.2019?!

Mit Gesetz vom 22.06.2019 hat der Gesetzgeber die Befreiung nach dem Stromsteuergesetz neu geregelt. Er hat dabei insbesondere nach dem neu gefassten § 9 Abs. 4 StromStG wesentlich mehr Stromsteuerbefreiungen bzw. -vergünstigungen als früher unter einen Erlaubnisvorbehalt gestellt. Dieser Vorbehalt ist gegenüber der früheren Gesetzesfassung deutlich ausgeweitet worden.
Zugleich hat der Gesetzgeber in einer Übergangsregelung angeordnet, dass die erforderliche Erlaubnis ab Inkrafttreten des Gesetzes zum 01.07.2019 widerruflich als erteilt gilt, wenn der Antrag auf Erlaubnis bis zum 31.12.2019 nachgereicht wird. Damit besteht für alle Betroffenen ein unmittelbarer Handlungsbedarf, zur Meidung von Steuernachteilen bis zum Jahresende den gebotenen Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zu stellen. Das entsprechende Formular findet sich im Internet unter www.zoll.de.